Franck und der Zweite Weltkrieg
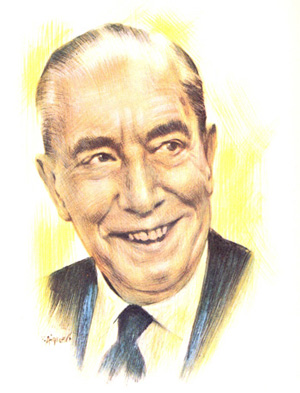
Die Beziehung zu Franck, der zahlreiche jüdische Bekannte und Berater hatte und Mitglied der von den Nationalsozialisten abgelehnten Freimaurer war, zerbrach schon vor seinem Tod im Jahr 1931 an ideologischen Differenzen: Hitler erzählte selber davon am 3. 2. 1942 abends in der Wolfsschanze: „In Berlin war Richard Franck einer der größten Idealisten, die ich kennengelernt habe. Er hat mich in München mit einem Dr. Kuhlo bekannt gemacht. Franck gedachte, uns mit Kapital zu helfen. Es sollte das Hotel Eden am Bahnhof gegen einen ganz billigen Zinssatz für mich erworben werden; das Kapital, es war 1923, sollte in Schweizer Franken gegeben werden, mit Papiergeld war nicht gedient. In der Sitzung des Konsortiums, das zum Zweck des Kaufabschlusses zusammengetreten war, stand Kuhlo auf: alles sei soweit, um mir den Erwerb einer Geschäftsstelle zu ermöglichen, ich müsse jetzt aber auch ihnen, dem Konsortium, welches auf Francks Veranlassung sich gebildet hatte, entgegenkommen. ‚In Ihrem Programm haben Sie den Freimaurer Paragraphen, den lassen Sie doch vielleicht...‘ Was, sage ich, behalten Sie Ihr Geld! Und bin hinaus. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass das lauter Freimaurer gewesen waren! Wie oft habe ich das dann später gehört: ja also, wenn Sie die Judengeschichte draußen lassen! Mit solchen Geschichten sind sie doch zu einer wirtschaftlich sehr drückenden Macht geworden. Ich habe nach der Vernichtung der Freimaurerei sagen hören, viele von ihnen seien glücklich, dass wir so vorgegangen sind!“[42] [Werner Jochmann (Hrsg.): Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944. Hamburg 1982, S. 208: 17. Januar 1942; ferner Wolfsschanze, 3. Februar.1942, abends.]
Auch Hermann Aust, ebenfalls durch seinen Schwiegersohn Dr. Alfred Kuhlo zunächst 1923 zum frühen Förderer der NSDAP geworden, zog sich nach schweren Zerwürfnissen, besonders innerhalb des katholischen Teils seiner Familie, von Hitler zurück. Nach dem Hitlerputsch kam es zum Zerwürfnis zwischen ihm und der Leitung der frühen NSDAP. Kuhlo - wie auch sein Schwiegervater - verkehrte viel mit jüdischen Bankiers und Künstlern, war aktiv in der Kirche und vor allem Anhänger des von den Nazis übel beschimpften Freimaurertums.
Das Verhältnis der Familie Franck zu Hitler blieb in weiterer Folge widersprüchlich. Den Anschluss befürworteten sie, schon aus wirtschaftlichen Gründen. Das nationalsozialistische Gedankengut allerdings teilten sie als Freimaurer, Rotarier und aktive evangelische Christen nicht. Hugo Breyer musste 1933 wegen seiner Ablehnung der Nationalsozialisten alle Ehrenämter zurücklegen und fand auch keine Wiederverwendung mehr in der Deutschen Wehrmacht.[43] [Pfundner / Wistinghausen, Neubronn, 70. ] Die Familie Franck musste bedeutende Grundstücke an die neu zu errichtenden Hermann Göring Werke abtreten. Gustav Heinrich Franck wurde Mitte März 1940 gezwungen, seine 1936 erworbene luxuriöse Schlosser-Villa auf der Gugl für den neu ernannten Regierungspräsidenten Dr. von Helms an das Reich abzutreten. Ihm wurde mitgeteilt: „Der Eigentümer werde sich wohl entschließen müssen, das Objekt freiwillig zu verkaufen und die Sache im gütlichen Einvernehmen zu regeln, da sonst dem Regierungspräsidenten wohl auch noch andere Mittel und Wege offen stünden, in Eigentum und Besitz dieses Objektes zu kommen.“[44] [OÖLA, LG, Sondergerichte, Schuber 615, Nr. 77/1948. ] Die Villa ging am 21. Mai 1940 um 160.000 RM an das Reich. Am 30. Jänner 1948 stellte Gustav Heinrich Franck einen Rückstellungsantrag. Die Villa wurde ihm laut Erkenntnis vom 1. März 1949 gegen Zahlung von 150.000 Schilling, die bei der Bank für Oberösterreich und Salzburg zugunsten Deutsches Reich hinterlegt wurden, zurückgestellt.[45] [Ebenda. ]

Hermann Wilhelm Breyer, der 1938 die Geschäftsführung in Linz übernommen hatte, wurde nach Kriegsende bescheinigt, sich allen diskriminierenden Maßnahmen gegen Juden oder Zwangsarbeiter widersetzt zu haben, einen jüdischen Mitarbeiter der Firma namens Immergut bis zu dessen Tod während des ersten schweren Luftangriffs auf Linz am 25. Juli 1944 die Werkspension und die Firmenwohnung weiter gewährt zu haben und auch andere der politischen Leitung nicht genehme Personen gedeckt zu haben. Kein einziges Werksmitglied sei je angezeigt worden, und es habe keine Diskriminierung der Ausländer gegeben. Das gute Verhältnis zu den Zwangsarbeitern sei auch dadurch zum Ausdruck gekommen, dass es Anfang Mai 1945 in der Firma zu keinerlei Plünderungen gekommen sei, obwohl alle bei Franck beschäftigten Ausländer und russischen Kriegsgefangenen innerhalb des Fabrikgeländes wohnten. Im Gegenteil, die letzteren hätten sich sogar angeboten, die Fabrik gegen etwaige Plünderungen von außen zu schützen, nachdem sie ihm als Zeichen der Freundschaft und zum Dank für die jederzeit gute Behandlung Wein und Brot gereicht hätten. H. W. Breyer war der Evangelischen Kirche all die Jahre über treu geblieben und hatte entsprechenden Bestätigungen und Zeugenaussagen zufolge die Kinder immer in den Religionsunterricht geschickt.[48] [Stadtarchiv Linz, Entnazifizierungsakt Hermann Wilhelm Breyer. ]
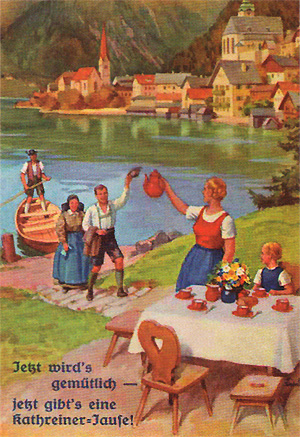
Der Konzern wurde 1938 neu gegliedert. Die Eroberungspolitik des Dritten Reichs machte die indirekte Lenkung der osteuropäischen Töchter im Wege der „Fundus“ überflüssig. Sie wurden der Fundus in Linz entzogen und direkt in den Konzern einbezogen. Die Heinrich Franck Söhne GmbH in Berlin übernahm nach der Angliederung des Sudetenlandes das Werk Komotau als Zweigniederlassung in eigene Regie. Die Betriebe in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Polen und der Tschechoslowakei wurden der Interfranck angegliedert. 1943 gab es auch den Plan einer Kaffeemittelfabrik in Kiew unter Leitung von Heinrich Franck Söhne.
Die Konstruktion der Schweizer Holding musste auf Druck der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, die ausländische Holdings ins Reich zurückzuführen versuchte, verändert werden. Weil den österreichischen bzw. nach dem Anschluss deutschen Aktionären der INGA im nationalsozialistischen Deutschen Reich die Enteignung der Holding-Beteiligungen drohte, entschloss man sich, ihre Beteiligungen an der INGA gegen Geschäftsanteile an der Berliner Heinrich Franck Söhne GmbH und der Kathreiner GmbH zu tauschen. Die Aktionäre erhielten für ihre INGA-Anteile direkte Anteile an Franck und an Kathreiner im Nominalwert von 12,042.500 RM. Die INGA reduzierte in dem nach dem Rechtsanwalt Dr. Carl A. Spahn als „Aktion Spahn“ benannten Transfer im Jahr 1938 ihre Beteiligung an der Berliner Heinrich Franck Söhne GmbH auf knappe 10 Prozent. Die INGA kaufte rund 32.000 ihrer 60.000 Aktien, d.h. mehr als die Hälfte ihres Aktienkapitals zurück. Die Bezahlung erfolgte zum geringeren Teil in Schweizer Franken, zum größeren Teil durch Überlassung von direkten Beteiligungen an den Tochtergesellschaften. Die rückgekauften Aktien wurden annuliert und das Kapital der INGA von 51 auf 24 Millionen Franken herabgesetzt. Auf jede der 60.000 INGA-Aktien wurde gleichzeitig ein neu geschaffener Genussschein emittiert, der zwar keine Mitgliedschaftsrechte verbriefte, aber die Verbindung mit den ausgeschiedenen Aktionären der INGA aufrecht erhalten sollte.
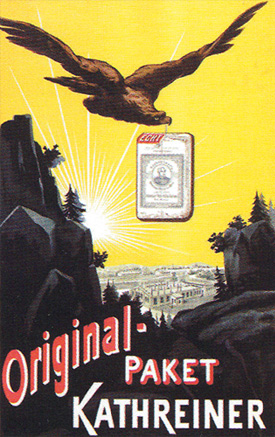
1939 ging die Selbständigkeit der österreichischen Franck- und Kathreiner-Gesellschaften verloren. Am 4. Dezember 1939 wurde das Vermögen der beiden Wiener Aktiengesellschaften Heinrich Franck Söhne AG und Kathreiner AG als Ganzes an die in Berlin bestandenen deutschen Gesellschaften, nämlich Heinrich Franck Söhne GmbH und Kathreiner GmbH gegen Überlassung von Geschäftsanteilen übertragen und der in die ZIMA Berlin umgewandelten ANGES unterstellt. Diese Übertragung sei durch den Anschluss Österreichs erzwungen worden, rechtfertigte man sich nach 1945.
Die österreichischen Gesellschafter erhielten für die Übertragung an die deutschen Unternehmen im Wege einer Kapitalerhöhung Geschäftsanteile im Nominalwert von RM 1.914.500.- Nach der Durchführung dieser Transaktionen waren die österreichischen Gesellschafter an der reichsdeutschen Gesellschaft mit Nominale 13.957.000 RM oder 39,9 Prozent beteiligt. Die Beteiligung der INGA an den deutschen Gesellschaften betrug nur mehr RM 5,684.000 oder 16,2 Prozent. Die Geschäftsleitung der INGA, deren Erträge auf ein Bruchteil der früheren Summen zurückgingen, lag während des Krieges in den Händen von Johann Heinrich Franck und Dr. Fritz Bohn. Die INGA verbreiterte ihre Basis in der Schweiz durch neue Beteiligungen, während die Verbindung zu den Gesellschaften und Betrieben im Großdeutschen Reich während der zweiten Kriegshälfte fast völlig abriss.
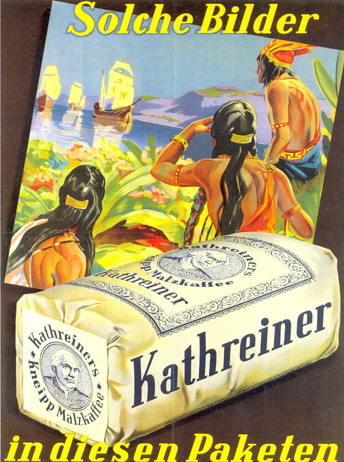
Auf einem Gesellschaftertreffen in Berlin am 31. Mai 1943 wurde beschlossen, den Firmensitz von Berlin nach Linz zu verlegen. Am 31. August wurde diese Entscheidung auf einem weiteren Treffen bestätigt. Der Hauptsitz in Berlin wurde in eine Niederlassung umgewandelt. Nachdem die beiden Berliner Gesellschaften ihren Sitz nach Linz bzw. Wien verlegt hatten, erfolgte mit Stichtag 28.12.1943 ihre Fusion zur neuen Firma Franck und Kathreiner Ges.m.b.H mit einem Stammkapital von 35 Mio. RM. Beteiligt waren die österreichischen Gesellschafter mit 39,9 Prozent, die INGA mit 16,2 Prozent und deutsche Gesellschafter mit 43,9 Prozent. Die rechtliche Verschmelzung trat mit 1. Jänner 1944 in Kraft. Vollzogen wurde sie nach den Bestimmungen des österreichischen GmbH-Gesetzes.[49] [Franck+Kathreiner Report: Microfilm Publication M1928, Gesellschafterliste der Heinrich Franck Söhne 1939 und der Franck und Kathreiner GmbH, Wien 1944. ]
Was weiter geschah, darüber gibt es zwei Versionen. Mit Gesellschafterbeschluss der a.o. Generalversammlung in Bad Wörishofen vom 6.2.1945 sollte der Hauptsitz der Gesellschaft von Wien nach Ludwigsburg verlegt werden. Ob damit eine Teilung in zwei getrennte Gesellschaften, eine deutsche und eine österreichische, beabsichtigt war, oder eine Abwertung der österreichischen Standorte zu Filialen von Ludwigsburg, ist unklar. Dass die Sitzverlegung bis Kriegsende im Handelsregister nicht zur Gänze vollzogen oder eingetragen war, erwies sich nach Kriegsende je nach Blickpunkt als Glücksfall oder Problem. Man konnte Franck & Kathreiner gegenüber den Alliierten als Unternehmen darstellen, das schon am 6.2.1945 österreichisch geworden sei. Oder man konnte es für ein reichsdeutsches Unternehmen halten, das 1945 entsprechend den Potsdamer Beschlüssen in alliierten Besitz übergehen sollte.

Auch Titze florierte. In der RM-Eröffnungsbilanz 1939 wurde die Titze AG mit einem Kapital von 1,5 Mio. RM ausgewiesen, das 1941 auf 1,65 Mio. RM und weiter auf 2,77 Mio. RM erhöht wurde. Der Umsatz von Titze betrug 1942/43: 3,7 Mio RM, 1944: 1,8 Mio. und 1945: 954000 RM; 1945 gab es 49 Beschäftigte. Im Aufsichtsrat waren: Gustav Heinrich Franck, Dr. Julius Grüll, Dr. Josef Dierzer, Ing. Otto Gottlieb, Eberhard v. Sick, Dr. Peter Bally, Rüdiger Vonwiller, als Direktoren fungierten: Lothar Kuhlmann, Rudolf Jünger und Ernst Moosmaier.
[41] Georg Franz-Willing: Ursprung der Hitlerbewegung 1919–1922. Preußisch-Oldendorf 1974, S. 289 f.
[42] Werner Jochmann (Hrsg.): Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944. Hamburg 1982, S. 208: 17. Januar 1942; ferner Wolfsschanze, 3. Februar.1942, abends.
[43] Pfundner / Wistinghausen, Neubronn, 70.
[44] OÖLA, LG, Sondergerichte, Schuber 615, Nr. 77/1948.
[45] Ebenda.
[46] Franck+Kathreiner Report: Microfilm Publication M1928, Mitteilung vom 5. Juni 1947.
[47] Stadtarchiv Linz, Entnazifizierungsakt Gustav Heinrich Franck.
[48] Stadtarchiv Linz, Entnazifizierungsakt Hermann Wilhelm Breyer..
[49] Franck+Kathreiner Report: Microfilm Publication M1928, Gesellschafterliste der Heinrich Franck Söhne 1939 und der Franck und Kathreiner GmbH, Wien 1944.
